von Friederike Boll
Mitte September verlieh die Humanistische Union ihren diesjährigen Fritz-Bauer-Preis an eine besondere Vereinigung – an die Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO). Damit verhalf sie einem Thema zu größerer Öffentlichkeit, das bislang wenig Beachtung gefunden hat: Rund zwei Drittel der insgesamt 60 000 Menschen im deutschen Strafvollzug arbeiten – allerdings werden ihnen in der Regel soziale Sicherung, kollektive Arbeitsrechte und ein fairer Lohn verwehrt.
Dabei sind auch hinter Gittern die gängigen Merkmale der Lohnarbeit gegeben. Denn die Arbeiterinnen und Arbeiter sind an die Weisungen der Betriebsleitung gebunden und in den arbeitsteiligen Betriebsablauf integriert. Die Tätigkeit von Gefangenen ähnelt somit in weiten Teilen jener von in Freiheit lebenden abhängig Beschäftigten. Einen wesentlichen Unterschied zu „draußen“ aber gibt es: den Arbeitsort.
Der Großteil der Gefängnisarbeit wird in der Anstaltsküche oder der Wäscherei verrichtet. Daneben gibt es meist gefängniseigene Betriebe, in denen die öffentliche Hand Möbel, Dienstkleidung oder Spielplatzmobiliar produzieren lässt. Zudem werden die Produktionsstätten samt benötigter Gefangenenarbeitskraft auch privaten Auftraggebern zur Verfügung gestellt: Dort werden Motorenteile, Gartenmöbel, Holzspielzeug, Fußball-Fanartikel oder Teile für Windkrafträder hergestellt.
Aus Sicht der privaten Unternehmer liegen die Vorteile für die Warenproduktion in Gefängnissen auf der Hand. Eine auch nur annähernd angemessene Entlohnung, adäquate Beiträge zu den Sozialversicherungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder anerkannte Gewerkschaften gibt es hier nicht. Zudem sind die Arbeitskräfte aufgrund der in zwölf Bundesländern gesetzlich verankerten Arbeitspflicht in Gefängnissen besonders kurzfristig einsetzbar. Entsprechend wirbt beispielsweise das Land Niedersachsen damit, dass Kunden „auf ihre Auftragsspitzen ohne eigene Investitionen flexibel reagieren [können]. Gefangenenarbeit macht die Verlagerung ins Ausland unnötig, stattdessen können örtliche Qualitäts- und Logistikvorteile genutzt werden.“
Sonderwirtschaftszone Gefängnis: Zwangsarbeit zu Hungerlöhnen
Gefängnisse sind somit wahre Sonderwirtschaftszonen, in denen die Gefangenen gleich in zweifacher Hinsicht sozialen Ausschluss erfahren: Ihnen wird nicht nur die Freiheit, sondern ihnen werden auch minimale soziale und arbeitsrechtliche Standards verwehrt. Dem Leitgedanken der Resozialisierung als wichtigstem „Vollzugsziel“ der Strafe hinter Gittern steht dies diametral entgegen.
Das zeigt sich vor allem am Einkommen der Gefangenen. Der durchschnittliche Stundenlohn liegt bei mageren 1,50 Euro. Qualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten zwar mitunter Zuschläge, dennoch kommen auch sie nach einem Arbeitstag in der Regel auf nicht mehr als 15 Euro.
Von dieser Ausbeutung profitieren auch die Justizvollzugsanstalten (JVA): Die externen Unternehmen zahlen ihnen pro arbeitendem Gefangenen schätzungsweise etwa das Zehnfache des ausgezahlten Lohns. Die Differenz streicht die JVA-Kasse ein. Die Grundkonstellation entspricht damit derjenigen der Arbeitnehmerüberlassung bei Leiharbeitsfirmen – jedoch ohne wichtige Schutzmechanismen wie den Gleichbehandlungsgrundsatz oder die Informationspflicht gegenüber den Betriebsräten des Entleihers.
Über ihr Einkommen dürfen die Gefangenen zudem nicht frei verfügen: Fast 60 Prozent des Lohns werden für den Tag der Entlassung „zwangsangespart“; den Rest erhalten die Insassen als „Hausgeld“, das sie größtenteils für Essen und Hygieneartikel aufwenden. Weil das Gefängnisessen nicht besonders üppig ist und auf Vorlieben oder auch nur auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung keine Rücksicht genommen wird, spielen zugekaufte Lebens- und Genussmittel eine wichtige Rolle. Einkaufen aber müssen die Gefangenen in den meist privatisierten Kiosken, die nur eine kleine Auswahl an Produkten zu überhöhten Preisen anbieten, noch dazu sind diese oft von miserabler Qualität. Alternativen dazu gibt es nicht: Pakete von Angehörigen oder Bekannten unterliegen strengen Auflagen – sowohl hinsichtlich der Menge (in der Regel maximal drei Pakete pro Jahr) als auch des Inhalts (keine frischen Lebensmittel und Hygieneprodukte).
Mit dem wenigen, was vom Hausgeld übrig bleibt, unterstützen die Insassen oft ihre Angehörigen oder aber sie bauen Schulden aus Gerichtsverfahren und Opferentschädigungen ab.
Ohne Versicherung hinter Gittern
Auch hinsichtlich der späteren sozialen Absicherung zahlt sich die Gefängnisarbeit nicht aus. Denn die Arbeiterinnen und Arbeiter werden nur ungenügend in die Sozialsysteme einbezogen und erfahren vielfältige – meist willkürliche – Benachteiligungen gegenüber Nichtgefangenen. Die Sozial- und Rentenkassen subventionieren so indirekt die günstigen Produktionsbedingungen – und damit die privaten Gewinne – der Unternehmen, die im Gefängnis produzieren lassen. Denn die Arbeit hinter Gittern gilt bislang nicht als sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, an dem sich auch der Arbeitgeber entsprechend beteiligt.
Außerdem müssen Gefangene etwa ein Drittel länger arbeiten, um nach der Haft Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu erhalten: Denn die Bundesagentur für Arbeit zählt nur jene Werktage, an denen die Gefangenen tatsächlich gearbeitet haben, während „draußen“ die gesamte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses zählt – also auch Wochenend-, Feier- und Urlaubstage –, um die benötigten 360 Tage Arbeit nachzuweisen.
Unterschiede werden auch bei der Berechnung der Ansprüche auf die sogenannte Freistellung von der Arbeitspflicht („Urlaub“) gemacht. So wird „Urlaub“ in der Regel nur en bloc gewährt. Die Urlaubstage selbst werden zudem nicht wie bei regulären Arbeitsverhältnissen in die Berechnung der Länge des Beschäftigungsverhältnisses einbezogen – und auf diese Weise verknappt.
Bis heute sind arbeitende Gefangene darüber hinaus nicht in die Renten-, Pflege- und Krankenversicherung integriert, obwohl das bereits die Strafvollzugsreform von 1977 für die Rentenkasse vorsah. Doch diese Vorgabe harrt unter Verweis auf die klammen öffentlichen Kassen auch fast vierzig Jahre danach ihrer Umsetzung: Auf Druck der Gefangenengewerkschaft GG/BO, des Komitees für Demokratie und Grundrechte sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ist das Thema zwar seit 2014 wieder in der parlamentarischen Debatte präsent. Jedoch lehnte im Dezember desselben Jahres eine große Mehrheit im Bundestag einen entsprechenden Gesetzentwurf gegen die Stimmen von Grünen und Linkspartei ab. Seither wurde das Thema zwar auf Initiative einzelner Länder auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz gesetzt, allerdings immer wieder vertagt und zuletzt im Juni 2016 zur weiteren Klärung an eine interministerielle Arbeitsgruppe weiterverwiesen, ohne dass es dazu eine politische Positionierung gegeben hätte.
Aus diesem Grund führt die Arbeit hinter Gittern nach wie vor zu keinerlei Rentenanwartschaften. Das Risiko, dass Gefangene in die Altersarmut geraten, ist damit – auch wegen der ohnehin erschwerten Erwerbschancen nach der Entlassung – enorm hoch. Das Fehlen von Rentenansprüchen bestraft die Gefangenen somit über die gerichtlich verhängte Strafe hinaus.
Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Krankenversicherung: Sie entfällt im Strafvollzug, da die Gesundheitsversorgung während der Haftzeit durch die JVA – mehr schlecht als recht – übernommen wird. So führen etwa die personelle Unterbesetzung und die Verweigerung einer freien Arztwahl zu Unterversorgung, und gerade bei Kurzzeithäftlingen wird oftmals ein akuter Behandlungsbedarf verschleppt. Nicht ohne Grund liegt die medizinische Versorgung hinter Gittern daher auf Platz eins der Beschwerdeliste von Gefangenen. Hinzu kommt, dass häufig auch die Angehörigen mit dem Entzug des Krankenversicherungsschutzes bestraft werden, sofern sie über den Insassen oder die Insassin mitversichert waren. Sie müssen sich fortan eigenständig versichern, was zu ungleich höheren Belastungen führt – in einer Situation, in der das Haushaltseinkommen sowieso schon massiv gesunken ist.
Zwar stellt die Arbeit im Gefängnis für die Insassen unbenommen eine wichtige Abwechslung im tristen Alltag dar. „Wer nicht arbeitet, ist 23 Stunden eingeschlossen und isoliert“, bringt es ein Gefangener auf den Punkt. Aber der Preis für ein wenig Abwechslung ist hoch. Besonders bitter ist, dass die mangelhafte soziale Absicherung ausgerechnet mit dem Resozialisierungsgedanken legitimiert wird: Gefangenenarbeit sei keine Lohnarbeit, lautet die gängige Begründung, sondern vielmehr eine therapeutische Maßnahme, die der „Wiedereingliederung in die Gesellschaft“ diene. Dahinter steht nicht zuletzt das stereotype Bild des „arbeitsscheuen Kriminellen“.
Mindestlohn statt Lohndumping
Ob all dies tatsächlich dem Leitgedanken der Resozialisierung zugute kommt, darf getrost bezweifelt werden. Dafür sprechen auch die Forderungen der Gefangenen, die auf eine Angleichung der sozialen Mindeststandards im Gefängnis wie auch in der Gesellschaft außerhalb der Mauern abzielen. Dazu zählen unter anderem die nach einer gleichwertigen Einbeziehung in die Sozialsysteme sowie nach Auszahlung des Mindestlohns bzw. von Beihilfen in ALG-II-Höhe für unverschuldet Unbeschäftigte.
Die Insassinnen und Insassen berufen sich dabei auf eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1998. Demnach kann Pflichtarbeit zur Resozialisierung nur beitragen, „wenn dem Gefangenen durch die Höhe des ihm zukommenden Entgelts in einem Mindestmaß bewusst gemacht werden kann, dass Erwerbsarbeit zur Herstellung der Lebensgrundlage sinnvoll ist“. Die Höhe des Arbeitsentgelts sei dabei ein Indikator, ob sich die Arbeit als Mittel zur Resozialisierung eigne, da die gesellschaftliche Reintegration dem Sozialstaatsprinzip entsprechen müsse. Der damalige Bundesverfassungsrichter Konrad Kruis betonte in einem Minderheitenvotum, dass sich die Angemessenheit der Löhne sogar an Tariflöhnen orientieren müsse.
In der Regel wird dem entgegengehalten, eine Orientierung am Tarif- bzw. Mindestlohn sei nicht gerechtfertigt, da Arbeitende innerhalb der Gefängnismauern bereits eine „Rundumversorgung“ erhielten. Tatsächlich aber ist diese Versorgung – wie gezeigt – keineswegs bedarfsdeckend. Und bei einer besseren Grundversorgung könnte die Gefängnisleitung durchaus auch einen Haftkostenbeitrag für Kost und Logis vom – fairen – Lohn abziehen, so wie es bei arbeitenden Freigängerinnen und Freigängern üblich ist.
Wo gearbeitet wird, braucht man Gewerkschaften
Gewerkschaften wie Verdi oder die IG Metall sollten die Forderungen der Insassinnen und Insassen unterstützen. Denn auch sie dürften kein Interesse an der Ungleichbehandlung Gefangener haben, fördert diese doch auch in den Betrieben außerhalb der Gefängnisse Lohn- und Sozialdumping. Doch bislang erhalten die Gefangenen von den Gewerkschaften „draußen“ nur wenig Unterstützung.
Um gegen die offenkundige Ausbeutung vorzugehen, gründeten Inhaftierte der JVA Tegel daher im Mai 2014 die bereits genannte GG/BO. Ihr gehören inzwischen rund 850 Mitglieder an. Deren Gewerkschaftsarbeit gestaltet sich hinter Gittern allerdings als überaus schwierig. Offene Versammlungen sind nicht möglich; Versuche in diese Richtung werden von den Anstaltsleitungen als Störung der Anstaltsruhe bzw. als Gefangenenmeuterei interpretiert, was nach Paragraph 121 StGb eine Straftat darstellen kann. Verweigern die Gefangenen daraufhin die Arbeit, können ihnen – aufgrund der gesetzlich verankerten Arbeitspflicht – sogar die Haftkosten auferlegt werden. So bleiben den Insassinnen und Insassen nur der halboffizielle Bummel- oder der Hungerstreik, bei dem eine Arbeitspflichtentbindung aus gesundheitlichen Gründen erfolgt.
Darüber hinaus ist die GG/BO seitens der Ministerien und Anstaltsleitungen noch immer nicht anerkannt. Mitgliedern wird zudem die Gewerkschaftspost vorenthalten, es kommt zu Besuchsrestriktionen, vermehrten Zellendurchsuchungen und schikanösen Kontrollen, verlängertem Einschluss in der Zelle oder Zwangsverlegungen und damit zur sozialen Isolierung.
Das in der Verfassung wie im Arbeitsrecht zentrale Maßregelungsverbot – „Wer sich gewerkschaftlich betätigt und seine Rechte wahrnimmt, darf nicht sanktioniert werden“ – gilt für Gefangene offenbar nicht. Stattdessen heißt es: „Arbeiten und Klappe halten!“ Dass Menschen hinter Gittern über weniger Mittel verfügen, sich gegen die Ausbeutung zu wehren, scheint da nur willkommen – auch und gerade der verantwortlichen Politik.
(aus: »Blätter« 11/2016, Seite 25-28)
Quelle: https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/november/zwangsarbeit-hinter-gittern
Die von den einzelnen AutorInnen veröffentlichten Beiträge geben nicht die Meinung der gesamten GG/BO und ihrer Soligruppen wieder. Die GG/BO und ihre Soligruppen machen sich die Ansichten der AutorInnen nur insoweit zu eigen oder teilen diese, als dies ausdrücklich bei dem jeweiligen Text kenntlich gemacht ist.
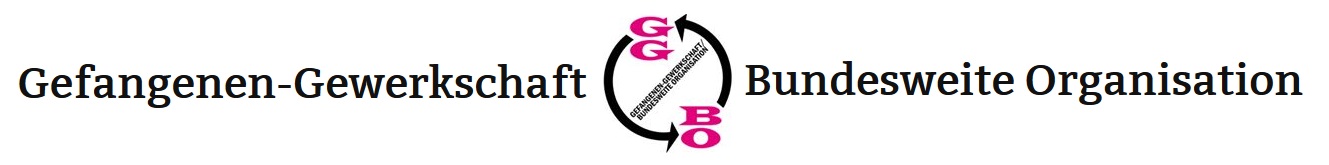

Es widerspricht sich doch in der Tat dass wenn man Arbeitslosenversicherung von dem “ Hungerlohn “ noch abgezogen bekommt und nicht als Arbeiter anerkannt wird.. “ Ich nenne es eine Rechtsbeugung “ – “ Die Mafia trägt schwarz „,in der Tat !!!Selbst den ausländischen-Gefangenen wird die Arbeitslosenversicherung abgezogen
obwohl feststeht dass die irgendwann in ihr Heimatland abgeschoben werden .Ich nenne es “ eine Bereicherung an Schutzbefohlene/Gefangene „und man sagt ihnen
dass sie in ihrem Heimatland, das Geld zurück fordern können“ Eine Lüge…
“ Sie lügen wie gedruckt und ich drucke was sie lügen “
Jürgen