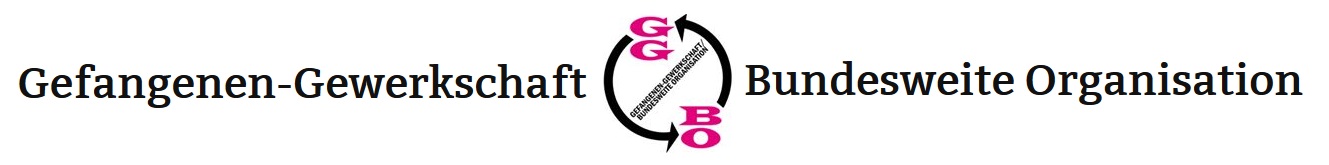Der Mindestlohn kommt. Doch die Untergrenze gilt nicht für alle. Schon gar nicht für Häftlinge, die in Gefängnissen arbeiten
Laura Beusmann
Vom 1. Januar 2015 an gilt in Deutschland der Mindestlohn – zumindest für diejenigen, die als Festangestellte in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis stehen. Ein Teil der arbeitenden Bevölkerung ist jedoch kategorisch vom Mindestlohn ausgeschlossen: Häftlinge.
Viele der derzeit rund 66.000 in deutschen Gefängnissen Inhaftierten sitzen nicht einfach nur ihre Strafe ab. Sie arbeiten; fertigen Kleinteile für Industriebetriebe, reinigen Kleidung in der Wäscherei oder schreinern Krippen aus Holz für den Online-Shop ihrer Justizvollzugsanstalt. Sie sind dazu verpflichtet – sofern sie nicht etwa krank, alkoholabhängig, Rentner oder lediglich in Untersuchungshaft sind. Die Stundenlöhne liegen weit unter 8,50 Euro – in Bayern etwa bei 1,50 Euro. Einen Status als Arbeitnehmer erhalten Häftlinge nicht – ihr Beschäftigungsverhältnis gilt als Resozialisierungsmaßnahme.
Lange Zeit wehrten sich die Häftlinge nicht dagegen; viele sind froh, eine Beschäftigung zu haben. Doch seit Frühjahr dieses Jahres und gerade jetzt, kurz vor dem Start des Mindestlohns, regt sich etwas hinter den Mauern.
Vergangenen Mai hat in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel deren damaliger Insasse Oliver Rast eine Gruppe gegründet, die er „Gefangenengewerkschaft“ nennt. 20 Prozent der Tegeler Insassen will sie heute zu ihren Mitgliedern zählen. Im streng rechtlichen Sinne muss eine Gewerkschaft Arbeitnehmer vertreten; dass die Gefangenengewerkschaft dies nicht kann, ist für ihre Arbeit nachrangig, sagt Gründer Rast: „Aufgabe einer Gewerkschaft ist es, die Arbeitsverhältnisse anzuprangern und Forderungen zu formulieren.“
Und das tut sie. Ihre Hauptforderungen sind die Eingliederung der im Knast Arbeitenden in die allgemeine Rentenversicherung und die Gültigkeit des Mindestlohns auch hinter Gittern.
Doch wie berechtigt ist die Forderung nach einem Mindestlohn? Schließlich haben die Gefangenen keinerlei Ausgaben für Miete und Verpflegung. Stattdessen kosten sie die Steuerzahlenden ein Vielfaches dessen, was sie durch ihre Arbeit erwirtschaften. Sie sind rechtskräftig verurteilt, sitzen also nicht grundlos ein, sondern weil sie sich nach richterlicher Auslegung der geltenden Gesetze etwas haben zuschulden kommen lassen. Ist es daher nicht legitim, dass der Großteil des mit Gefängnisarbeit erwirtschafteten Umsatzes nicht in die Taschen der Verurteilten, sondern in die Haushalte der Bundesländer fließt, die die Haftanstalten unterhalten?
Ein emanzipatorischer Akt
Oliver Rast ist im September nach drei Jahren aus der Haft entlassen worden. Die Strafe hatte er absitzen müssen, weil er Mitglied der „militanten gruppe“ und an einem Anschlag beteiligt gewesen sein soll. Jetzt kämpft er für mehr Freiheit hinter Gefängnismauern: „Die Gewerkschaftsgründung ist ein emanzipatorischer Akt der Insassen, sich aus ihrer Lethargie, Vereinzelung und Bevormundung herauszulösen und ihre Rechte einzufordern.“
Im Jargon der Justizvollzugsanstalten ausgedrückt lässt sich die Gewerkschaftsgründung als eine Art eigenverantwortliche Resozialisierungsmaßnahme bezeichnen: Aus passiven Gefangenen werden sozial engagierte Bürger, die sich aktiv für ihre Rechte einsetzen – und zwar innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber über das Tätigkeitsfeld der gesetzlich vorgesehenen Insassenvertretung hinausgehend. Denn Letztere ist nur innerhalb der eigenen Haftanstalt tätig und bei ihren Entscheidungen an die Rücksprache mit der Anstaltsleitung gebunden und daher „völlig entpolitisiert“, sagt Rast. Doch ein Mindestlohn im Knast scheint gegenwärtig unvereinbar mit der Logik des Strafvollzugs, er mutet utopisch an. Ist die Gewerkschaftsgründung folglich nicht viel mehr als ein Akt des freien Denkens, ohne jegliche Konsequenzen; ganz nach dem Motto des alten deutschen Volksliedes „Die Gedanken sind frei“?
Tatsächlich hat die Gefangenengewerkschaft für ihre andere große Forderung, die nach der Eingliederung Strafgefangener in die Rentenversicherung, bereits eine Fürsprecherin gefunden, mit der sie selbst nicht gerechnet haben kann: Anfang Dezember setzte ausgerechnet eine CDU-Politikerin, die Justizministerin Mecklenburg-Vorpommerns Uta-Maria Kuder, die Frage der Rentenversicherung für Gefangene auf die justizpolitische Agenda. Wenn sich die Landesjustizminister im Frühjahr 2015 in Stuttgart treffen, dann will sie mit ihren Kollegen über das Thema sprechen.
Von Oliver Rast und der Gefangenengewerkschaft hat sich die Ministerin dabei aber wohl nicht inspirieren lassen – die in Nordrhein-Westfalen groß gewordene Kuder verwies darauf, dass das Thema in den 1970er Jahren schon einmal in der Bundesrepublik diskutiert worden war, dann aber folgenlos blieb.
Eingeschränkte Produktivität
Indessen hat die Forderung nach dem allgemeinen Mindestlohn für Strafgefangene, wie es ihn in Italien oder Österreich schon gibt, in Deutschland noch keine prominenten Fürsprecher gefunden. Berlins CDU-geführte Senatsverwaltung für Justiz antwortete auf eine Anfrage der Linksfraktion im Sommer lapidar, die Einführung des Mindestlohns in Justizvollzugsanstalten sei nicht geplant.
Schließlich sei die Produktivität eines „erheblichen Teils“ der arbeitenden Gefangenen wegen mangelnder Kompetenzen wie Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit und Frustrationstoleranz „stark eingeschränkt“ und ohnehin müssten die Gefangenen ja keine Haftkosten bezahlen. Mit anderen Worten: Sollen sie doch froh sein, dass sie überhaupt irgendetwas für ihre Arbeit bekommen.
Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 52/14